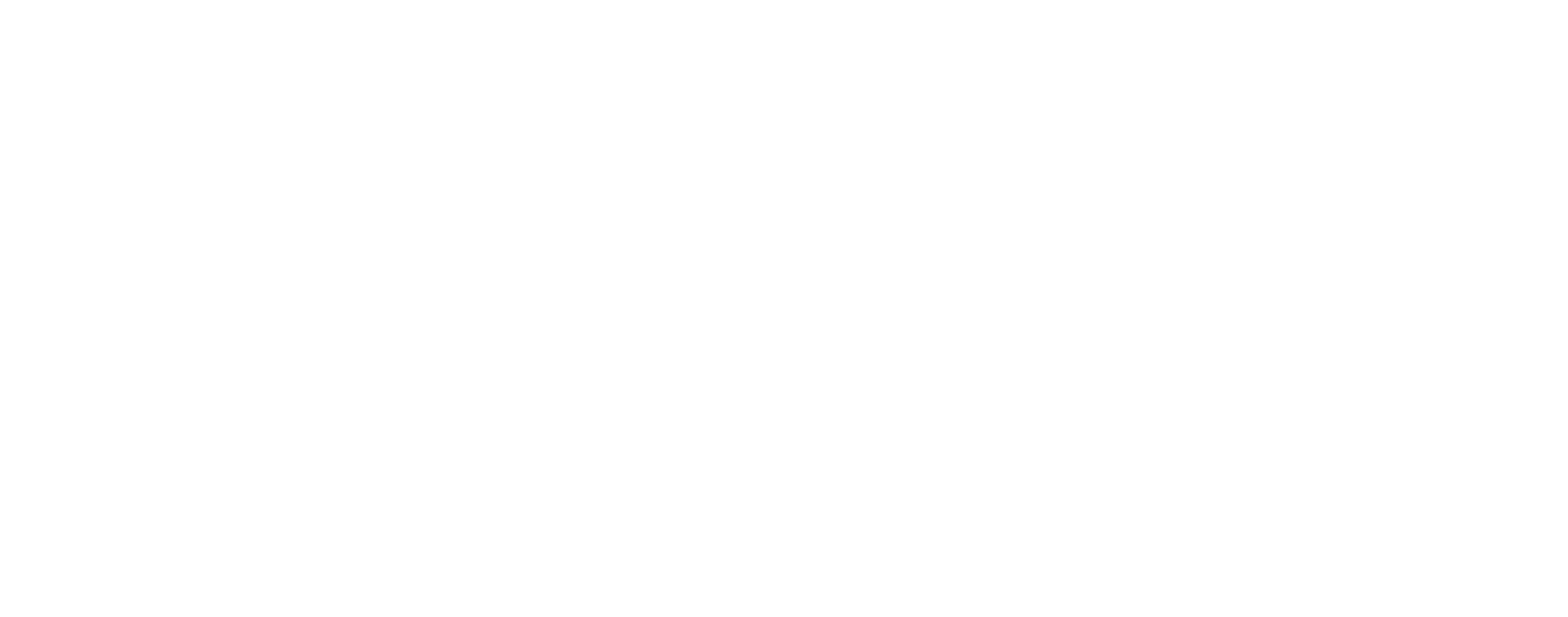Fragen und Antworten – Energiewende gemeinwohlorientiert gestalten (FAQ)

Welche Möglichkeiten gibt es, die Energiewende vor Ort zu gestalten?
Zentrale Aushandlungsprozesse in der Energiewende finden vor Ort in den Regionen und Kommunen statt. Hier muss es gelingen, die Transformation demokratisch zu gestalten, indem lokale Interessen berücksichtigt werden und der gesamte Ablauf transparent mit der Öffentlichkeit kommuniziert wird.
Ein wesentlicher Hebel liegt darin, dass Kommunen die Flächensteuerung für erneuerbare Energien, insbesondere für Windkraft, vorausschauend und proaktiv gestalten (–> Artikel “Wie können Kommunen Flächen für den Windkraftausbau bestmöglich steuern?”). Neben einem räumlich gesteuerten Ausbau der erneuerbaren Energien können außerdem passende Modelle der finanziellen Teilhaben und lokalen Wertschöpfung für die Kommune und die Menschen vor Ort entwickelt und mit den Vorhabenträgern verhandelt werden. (–> Link: Welche Möglichkeiten der finanziellen Teilhabe gibt es für Kommunen und die Menschen vor Ort?”).
…weiterlesen
Einen besonderen Fall stellt das sogenannte kommunale Flächenpooling dar, wobei sich die Flächeneigentümer in einem bestimmten Gebiet zusammenschließen und die Kommune den Prozess der Flächensicherung für neue Windenergieanlagen koordiniert. Dies sichert einerseits eine entsprechende räumliche Steuerung sowie Verteilungsgerechtigkeit unter den Flächeneigentümern und ermöglicht andererseits ebenfalls die Ausarbeitung und Verhandlung von Modellen der finanziellen Teilhabe für die Allgemeinheit im Rahmen der Pachtverträge.
Weitere Informationen:
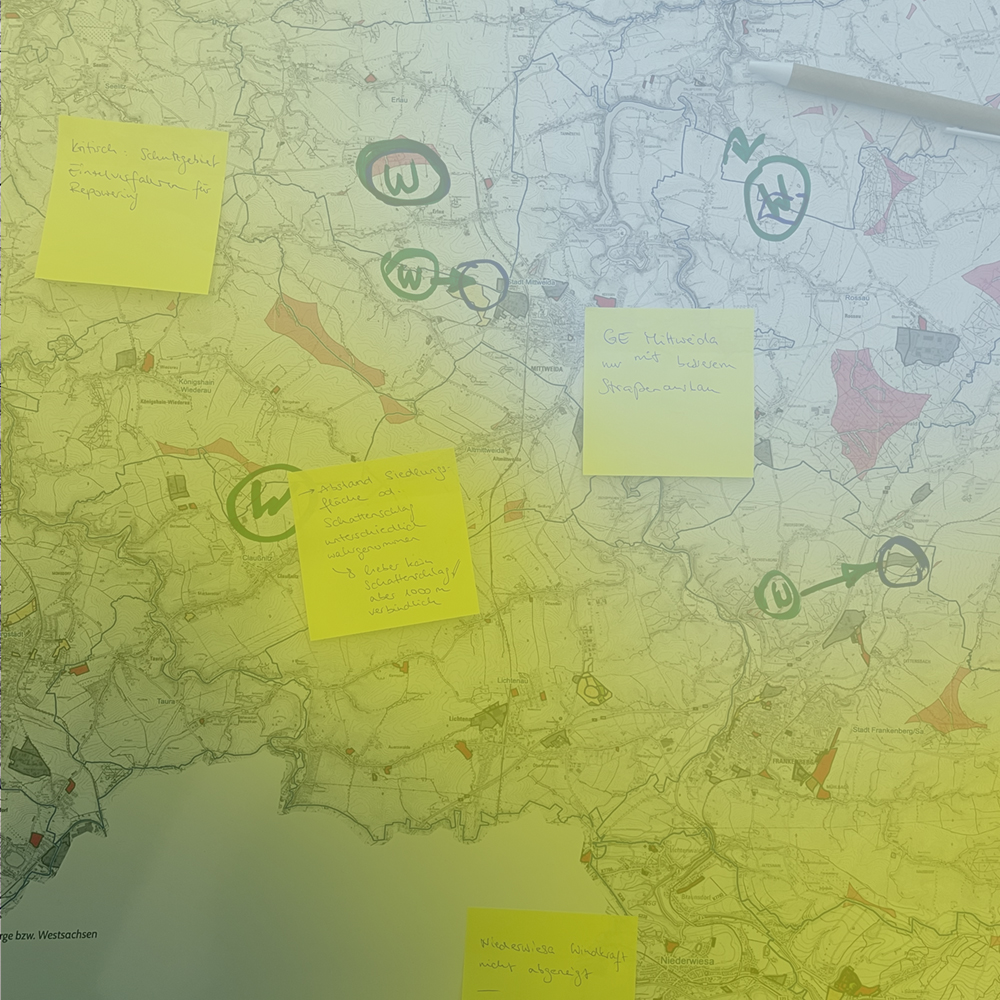
Wie können Kommunen Flächen für den Windkraftausbau bestmöglich steuern?
Um die gesetzliche Vorgabe für die installierte Windenergieleistung nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (157 Gigawatt bis zum Jahr 2035) erreichen zu können, wurde festgelegt, dass zwei Prozent der Fläche Deutschlands für Windenergieanlagen ausgewiesen werden müssen. Die Ziele des sog. Wind-an-Land-Gesetzes (WindBG) werden durch die Regionalplanung umgesetzt. Würde das 2‑Prozent-Flächenziel bis spätestens Ende 2032 nicht erreicht, wäre die räumliche Steuerung von Windkraftanlagen in den Planungsregionen kaum noch möglich. Auch derzeit geltende Landesregelungen, z.B. über den Mindestabstand zwischen Wohngebäuden und Windkraftanlagen, würden ausgehebelt.
…weiterlesen
Windenergieanlagen sind grundsätzlich außerhalb von Siedlungsbereichen (im Außenbereich) privilegiert zulässig. Die Genehmigung kann nur abgelehnt werden, wenn öffentliche Belange (z. B. Naturschutz, Denkmalschutz, Abstand zu Wohnbebauung) entgegenstehen. Ohne klare Planung können Windkraftanlagen an vielen Orten errichtet werden, was häufig als “Wildwuchs” bezeichnet wird.
Die Privilegierung entfällt, wenn ein gültiger Regional- oder Flächennutzungsplan Vorrangflächen festlegt und außerhalb dieser Flächen Windenergie ausschließt. Hierbei braucht es ein schlüssiges Konzept, eine Verhinderungsplanung ist nicht erlaubt. Die Gemeinden vor Ort wissen aufgrund ihrer örtlichen Nähe am besten, welche Flächen geeignet sind und in der Bevölkerung Akzeptanz finden. Geeignete Windenergieflächen sollten daher möglichst auf lokaler Ebene aktiv gesucht, unter Beteiligung der Öffentlichkeit ausgewählt und rechtssicher ausgewiesen werden. So können Flächenkonflikte möglichst gering gehalten und der Windenergieausbau strategisch gelenkt werden, beispielsweise auf Flächen, in denen die Anlagen für eine geringere Beeinträchtigung der Bevölkerung sorgen oder in Nähe zu größeren Stromabnehmern.
Kommunen können die Windenergienutzung auf ihrem Gebiet gezielt steuern, indem sie Bebauungspläne für einen festgelegten Bereich oder Flächennutzungspläne für das gesamte Gemeindegebiet aufstellen. Sie können auch dann Flächen für Windenergie ausweisen, wenn die regionalen Planungen in ihrem Gebiet keine Windenergieflächen vorgesehen haben (sog. Gemeindeöffnungsklausel bis Ende 2027). Eine enge Abstimmung mit der zuständigen Regionalplanungsstelle ist hier dennoch ratsam.
Nach welchen Kriterien Windenergiegebiete ausgewiesen werden, hängt auch von Vorgaben des Bundeslandes und von der Region ab. Neben der Regionalplanungsstelle kann deshalb auch der Austausch mit der für die Genehmigung der Windenergieanlagen zuständigen Behörde im Landkreis hilfreich sein.
Weitere Informationen:

Wie und wann sollten Kommunen die Bürgerinnen und Bürger informieren und beteiligen?
Grundsätzlich empfehlen wir, so frühzeitig und umfangreich wie möglich in die Kommunikation zum Ausbau von erneuerbaren Energien zu gehen, auch unabhängig von konkreten Projektvorhaben. Informationen und der Austausch über die Rahmenbedingungen, gesetzlichen Vorgaben und kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten (–> Link: Welche Möglichkeiten der finanziellen Teilhabe gibt es für Kommunen und die Menschen vor Ort?) können dazu beitragen, allgemeine Skepsis abzubauen und die Trägerschaft für die Energiewende vor Ort zu stärken. Denn die Energiewende ist nicht nur eine technische, sondern vor allem eine gesellschaftliche Transformationsaufgabe. Transparente Kommunikation und ein Dialog mit allen Betroffenen auf Augenhöhe ist daher zu jedem Zeitpunkt wichtig, um den Prozess demokratisch zu gestalten.
…weiterlesen
Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen zeigen, dass es insgesamt einen hohen Bedarf an allgemeiner Information gibt, um konstruktive Debatten zur Energiewende und zum Windkraftausbau vor Ort zu führen. Geeignet sind dabei Dialogformate, die den Raum für Rückfragen ebenso wie für kritische Fachgespräche geben, zum Beispiel im Rahmen eines Infomarktes, auf dem eine Breite an Themen und Positionen an verschiedenen Infoständen vertreten ist. Darüber hinaus können spezifische Themen, wie die Flächenauswahl für Windenergieprojekte oder die passenden Modelle für lokale Wertschöpfung und finanzielle Teilhabe, am besten im konstruktiven Dialog in Kleingruppen verhandelt werden. Hier eignen sich sog. Werkstattgespräche, in denen in moderierten Runden gemeinsam an einem konkreten Thema gearbeitet wird.
Um einen möglichst unvoreingenommenen Austausch zu ermöglichen, sollte die Beteiligungsveranstaltung von der Gemeinde getragen und ggf. durch eine unabhängige Moderation unterstützt werden.
Um einen möglichst unvoreingenommenen Austausch zu ermöglichen, sollte die Beteiligungsveranstaltung von der Gemeinde getragen und ggf. durch eine unabhängige Moderation unterstützt werden.
Weitere Informationen:
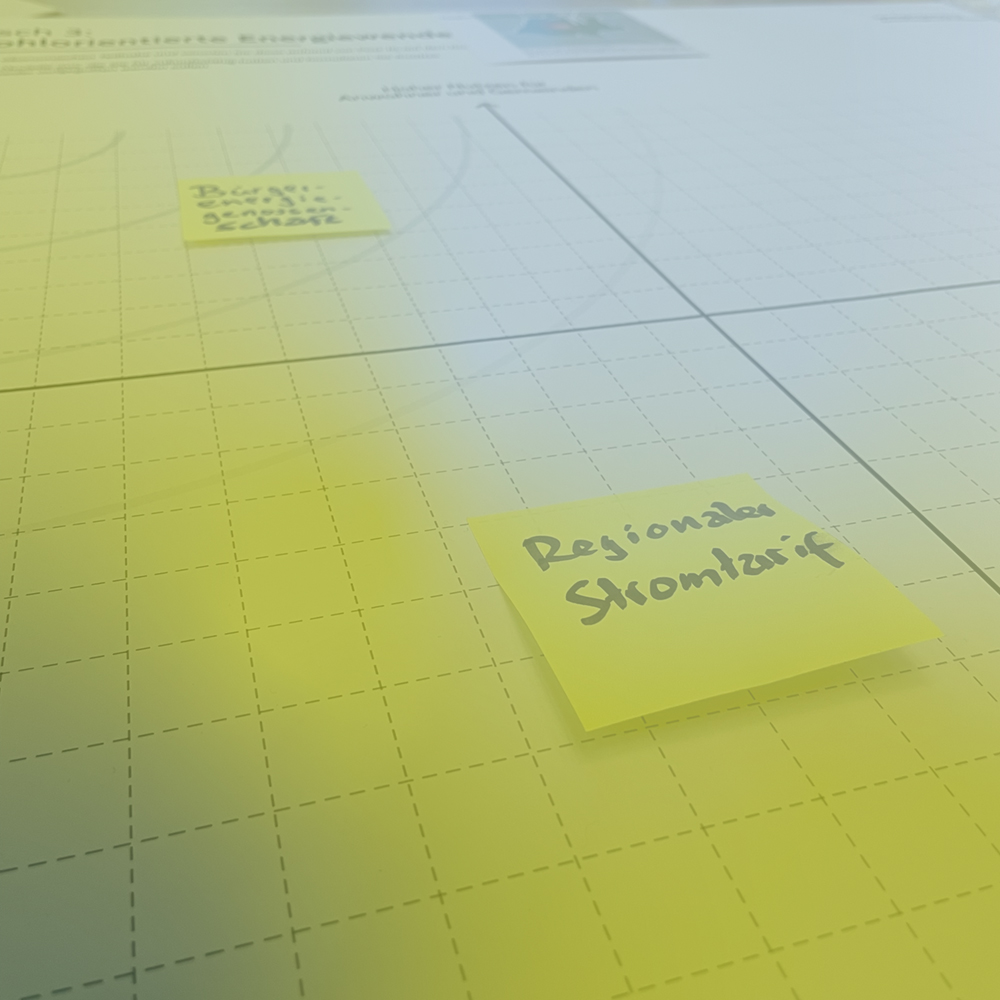
Welche Möglichkeiten der finanziellen Teilhabe gibt es für Kommunen und die Menschen vor Ort?
Gesetzliche Rahmenbedingungen wie §6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder Landesgesetzgebungen zu Akzeptanz und finanzieller Teilhabe ermöglichen erstmals eine rechtssichere finanzielle Beteiligung von Kommunen, entweder im Rahmen von einvernehmlichen Verträgen (§6 EEG) oder verpflichtenden Zahlungen (Teile der Landesgesetzgebungen).
Die vorgesehenen Zahlungen und Leistungen werden jedoch zum Teil als nicht ausreichend für die entstehenden Beeinträchtigungen vor Ort angesehen.
…weiterlesen
Zusätzlich gibt es weitergehendes Wertschöpfungspotenzial durch den Ausbau der erneuerbaren Energien: preissichere Wärmeversorgung durch Sektorkopplung, Bürgerstromtarife, Bürgerenergieprojekte oder Sonderfonds für Gemeinwohlaufgaben. Mittel beispielsweise für kostenloses Kitaessen werden häufig als positives Signal gewertet, bieten aber keine Möglichkeit für langfristige Investitionen. Eine allgemeine Einschätzung, was geeignet und gerecht ist, lässt sich jedoch nicht abgeben. Dies hängt stark vom Gerechtigkeitsempfinden sowie den sozioökonomischen Rahmenbedingungen vor Ort ab. So sind die Investitionsmöglichkeiten von Haushalten und Kommunen insbesondere in strukturschwachen Räumen begrenzt. Aber auch die Demografie (je älter, desto weniger wird individuell investiert) sowie Ressourcen und Gestaltungswille und ‑spielraum der kommunalen Akteure vor Ort spielen eine Rolle. Um herauszufinden, welcher der passende Weg für Ihre Kommune ist, eignet sich ein Werkstattgespräch zu den unterschiedlichen Modellen der lokalen Wertschöpfung und finanziellen Teilhabe.
Weitere Informationen:
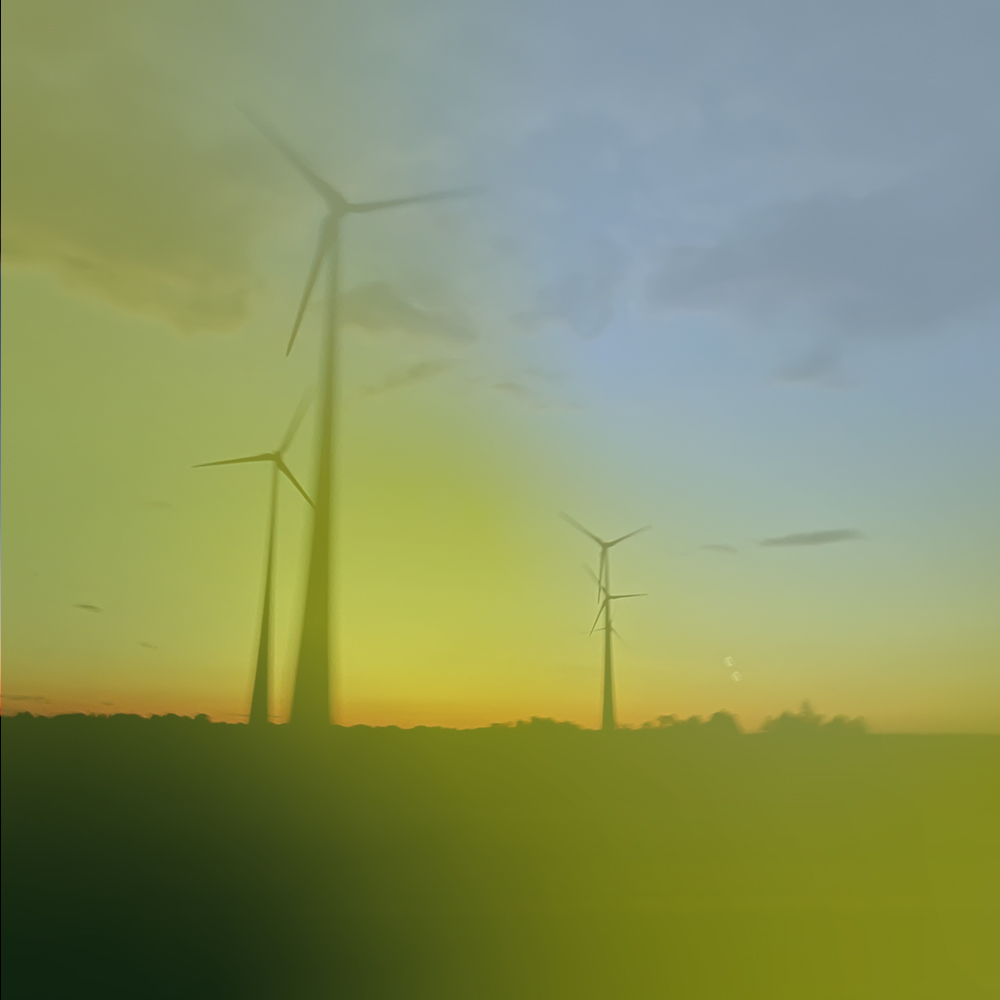
Gibt es einen Zusammenhang zwischen finanzieller Teilhabe und Akzeptanz?
Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass die kommunale Gestaltung und finanzielle Beteiligung der Kommune als wesentlich bedeutender wahrgenommen werden als die individuelle finanzielle Teilhabe der Anwohnenden.
Finanzielle Entschädigungen auf individueller Ebene werden hingegen oft als “Bestechung” und damit als unmoralisch abgelehnt. Besitzanteile an Energieunternehmen gelten als attraktivere Form der finanziellen Beteiligung, bergen jedoch Risiken und die Möglichkeiten zu investieren, sind gesellschaftlich und demografisch ungleich verteilt. Insbesondere strukturschwache, ländliche Regionen mit wenig Investitionsspielräumen sind hier benachteiligt.
…weiterlesen
Regionale Disparitäten können somit verstärkt werden. Ebenso können soziale Ungleichheiten dahingehend verstärkt werden, dass Anwohnende mit niedrigem Einkommen oder ohne Sparguthaben hier nicht profitieren können. Für ältere Menschen sind langfristige Investitionszeiträume zudem unattraktiv.
Am positivsten wird daher die Kompensation über die Kommune bewertet, da Betroffene es tendenziell bevorzugen, wenn ihre Gemeinde von den Projekten profitiert und die Mittel dem Gemeinwohl, etwa durch öffentliche Einrichtungen, zugutekommen.
Eine „gesellschaftliche Trägerschaft“, wonach Akteure bereit sind, Entscheidungen mitzutragen, denen sie eigentlich ablehnend gegenüberstehen, kann vor diesem Hintergrund nur durch ernst gemeinte Teilhabeangebote erreicht werden.
Weitere Informationen:

Wo gibt es allgemeine Fachinformationen und Hintergründe zur Energiewende?
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, werden Wind- und Solarenergie massiv ausgebaut. Im Jahr 2030 sollen demnach 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen, um im Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen.
Die Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Quellen ist dabei nicht nur eine technologische, sondern vor allem auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Sachliche Informationen sind eine wesentliche Grundlage für den konstruktiven Dialog, damit die Energiewende in einem demokratischen Rahmen erfolgreich gestaltet werden kann.
Weitere Informationen: